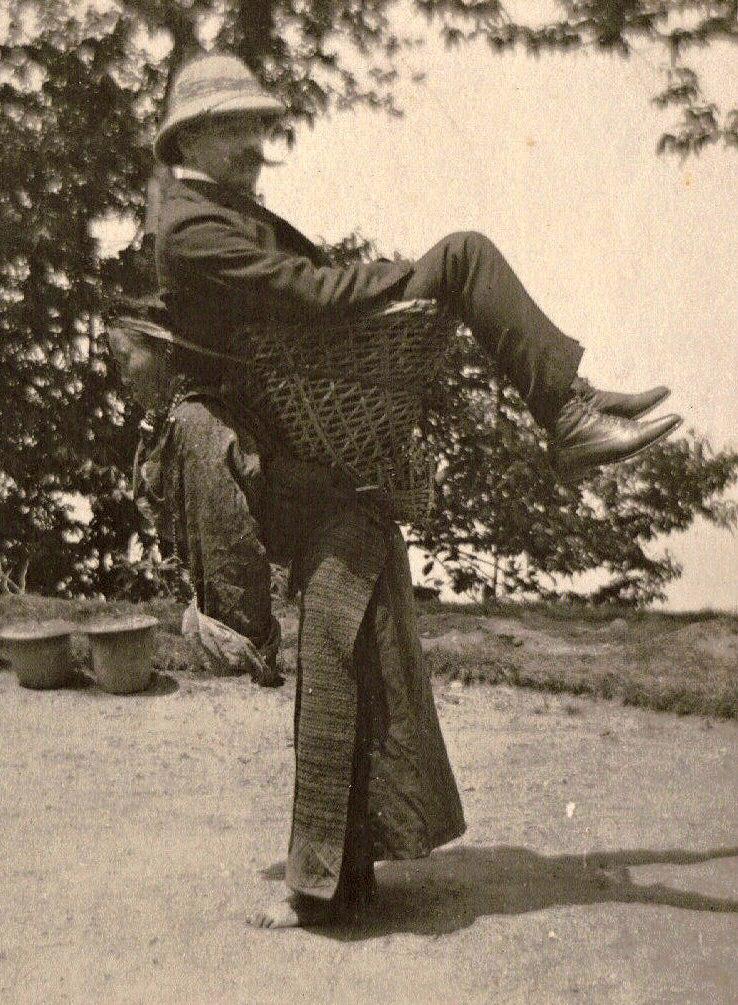Der erste Band des Hauptwerkes von Karl Marx, „Das Kapital“, beginnt mit dem Kapitel über „Ware und Geld“ und dem Hinweis, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrsche, erscheine als eine „ungeheure Warensammlung“.
In den folgenden Kapiteln wird der innere Mechanismus dieser kapitalistischen Produktionsweise analysiert. Im vorletzten Kapitel zerreißt Marx unter dem Titel „Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation“ den Irrglauben, der Kapitalismus sei durch einen Akt ökonomischer Vernunft, durch eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen freien Menschen unterschiedlicher Stände in die Welt gekommen. Marx zeichnet die „Blutgesetzgebung“ nach, durch die gewaltsam Millionen Menschen von ihrem Privateigentum an Grund und Boden und eigenen Produktionsmitteln wie Werkzeugen und Vieh getrennt und in die völlige Abhängigkeit von Lohn zahlenden Unternehmern hineingezwungen worden sind. Diese Abhängigkeit, die Blutspur des damaligen Schöpfungsaktes, zieht sich bis in unsere Gegenwart.
Jeder Autor eines großen Werkes überlegt sich mit Bedacht vor allem den ersten und den letzten Satz seines Buches, sein erstes und sein letztes Kapitel, zwischen denen er den Bogen seiner Argumentation spannt. Das ist bei Marx nicht anders. Es ist daher kein Zufall, dass dieses Buch, das mit der „Ware“ beginnt, mit der „Kolonisationstheorie“ und in diesem letzten Kapitel mit den folgenden Sätzen endet: „Jedoch beschäftigt uns hier nicht der Zustand der Kolonien. Was uns allein interessiert, ist das in der neuen Welt von der politischen Ökonomie der alten Welt entdeckte und laut proklamierte Geheimnis: Kapitalistische Produktions- und Akkumulationsweise, also auch kapitalistisches Privateigentum, bedingen die Vernichtung des auf eigner Arbeit beruhenden Privateigentums, das heißt die Expropriation des Arbeiters.“
Der Satz widerlegt die seit nunmehr über 150 Jahren verbreitete Lüge, die Kommunistinnen und Kommunisten wollten das Privateigentum abschaffen. Das ist deshalb ein so abgeschmackter Unsinn, wie Marx vielleicht formuliert hätte, weil dieses Privateigentum für die Masse der Bevölkerung gewaltsam durch die Profiteure des kapitalistischen Systems bereits mit der Errichtung dieses Systems bis auf einen kläglichen Rest, von dem niemand seine Existenz bestreiten kann, abgeschafft wurde.
Die beiden letzten Sätze des „Kapitals“ sind zuweilen als Hinweis gewertet worden, Marx wäre das Schicksal der Kolonien der westeuropäischen Mächte weitgehend egal gewesen. Weit gefehlt – immer wieder empören sich Marx und sein engster Freund Friedrich Engels über das Blutbad, das der Kapitalismus bereits zu ihrer Zeit in den von den kapitalistischen Nationen unterdrückten Teilen der außereuropäischen Welt anrichtet, und begrüßen jeden Schritt der Gegenwehr der unterdrückten Völker. Der Hauptzweck des „Kapitals“ aber ist es, den Mechanismus offenzulegen, nach dem dieses System bis heute funktioniert. Und dazu schließt Marx das Buch ab mit dem Hinweis, dass die Kolonisierung der außereuropäischen Welt durch die (west-)europäischen Staaten und das ganze System nicht funktionieren können ohne die massenhafte, gewaltsame Zerstörung der in dieser Welt entstandenen gesellschaftlichen Strukturen – oder, wie er betont: „Man sah: Die Expropriation der Volksmasse von Grund und Boden bildet die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise.“
Dieser innere Zusammenhang hat sich im weiteren Verlauf der Geschichte Jahrzehnt für Jahrzehnt bestätigt und rückte deshalb mit innerer Logik ins Zentrum der analytischen Arbeit solcher in der Tradition von Marx und Engels stehender Theoretiker wie Wladimir Iljitsch Lenin und Rosa Luxemburg.
Vor allem in den Diskussionen innerhalb der Linken in Westeuropa und den USA – also den bis vor Kurzem die Welt ökonomisch, kulturell, politisch und militärisch beherrschenden Teilen des Globus – gab es eine starke Tendenz, die Abhängigkeit sowohl der Entstehung als auch der Entwicklung des Kapitalismus von der Kolonisierung des Restes der Welt zu unterschätzen. Das widerspiegelte sich in einem „Auseinanderdriften“ des vom italienischen Marxisten Domenico Losurdo so bezeichneten „westlichen“ vom „östlichen Marxismus“. Auch dank seiner klaren Positionen setzt sich nun auch im Westen zunehmend die Einsicht durch, die – ausgehend von Lenin und Luxemburg – bei Revolutionären wie Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh bis hin zu Xi Jinping (also außerhalb des über die sozialistischen Revolutionen dieser Sphären zuweilen naserümpfenden westlichen Kreises) Allgemeingut geworden ist: Es kann keinen weltweiten Sieg des Sozialismus – geschweige denn die Errichtung des Kommunismus – geben, ohne die nationale Befreiung von der vom westeuropäischen und US-amerikanischen Kapitalismus ausgehenden Kolonisierung der Welt zu vollenden. Weil das so ist, rückt objektiv der Kampf gegen die verzweifelten Bemühungen des USA/EU/Japan-Blocks, mit Waffengewalt seinen Abstieg im Kampf gegen die alten Kolonien zu verhindern, in den Mittelpunkt aller revolutionären Tätigkeit – auch in diesen Zentren des Imperialismus. Letztlich liegt dies in der Logik, die Marx im „Kapital“ von der „Ware“ zum „Kolonialsystem“ entwickelt. Erst die Beseitigung des Kolonialsystems erlaubt die Überwindung der Ware als ökonomischer Kategorie, unter deren Knechtschaft die ganze Welt gezwungen wird. Alles andere ist Traumtänzerei.
Diesen Text hat der Autor für die Rubrik „Marx Engels aktuell“ auf marx-engels-stiftung.de geschrieben. In dieser Serie spiegelt Manfred Sohn einmal im Monat aktuelle Ereignisse an Aussagen der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Es geht darum, mit der Marxschen Methode alles kritisch zu hinterfragen, darum, die moderne Welt besser zu verstehen. Wir haben den Text gekürzt und redaktionell geringfügig bearbeitet.