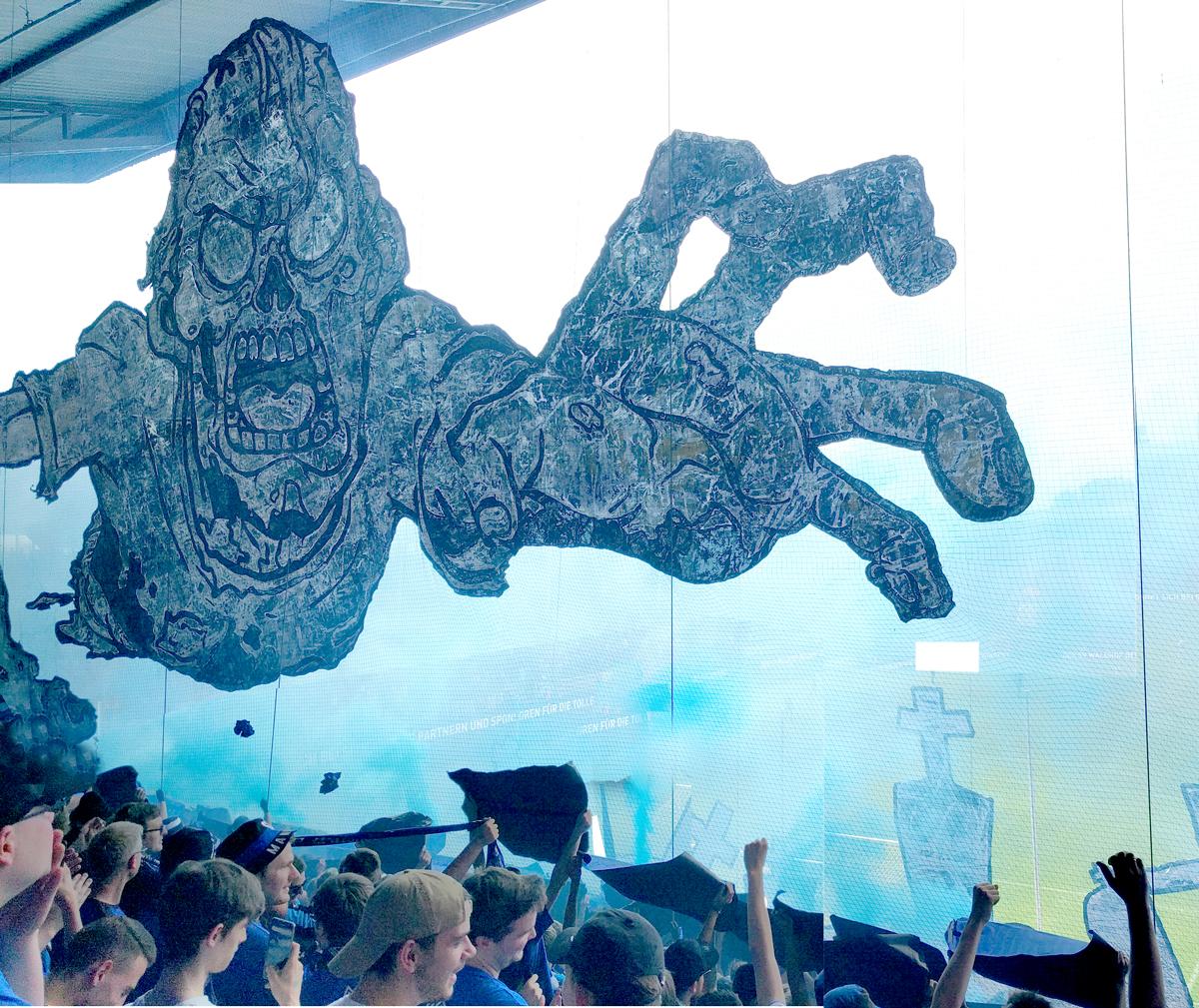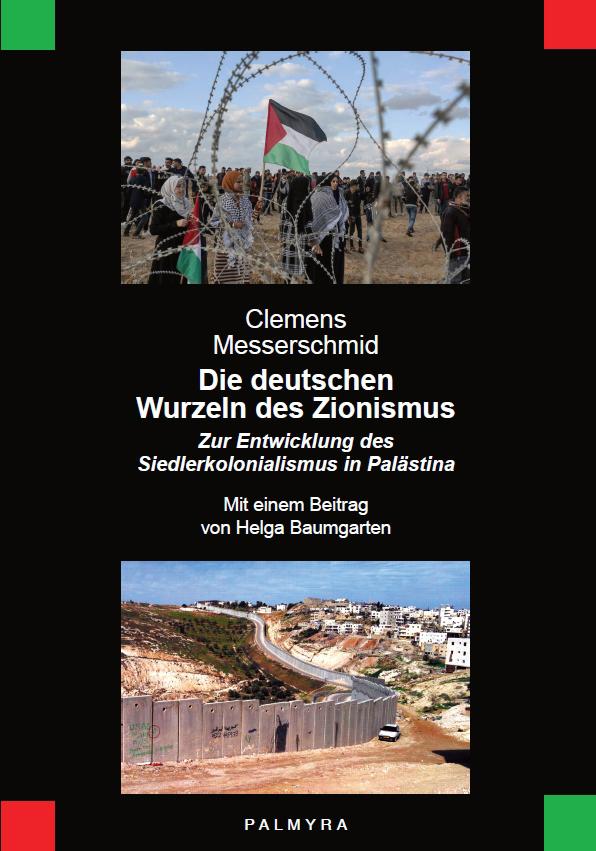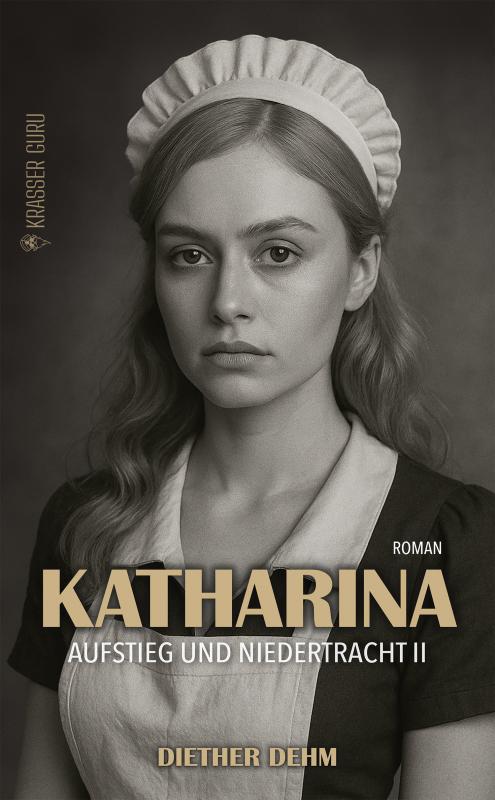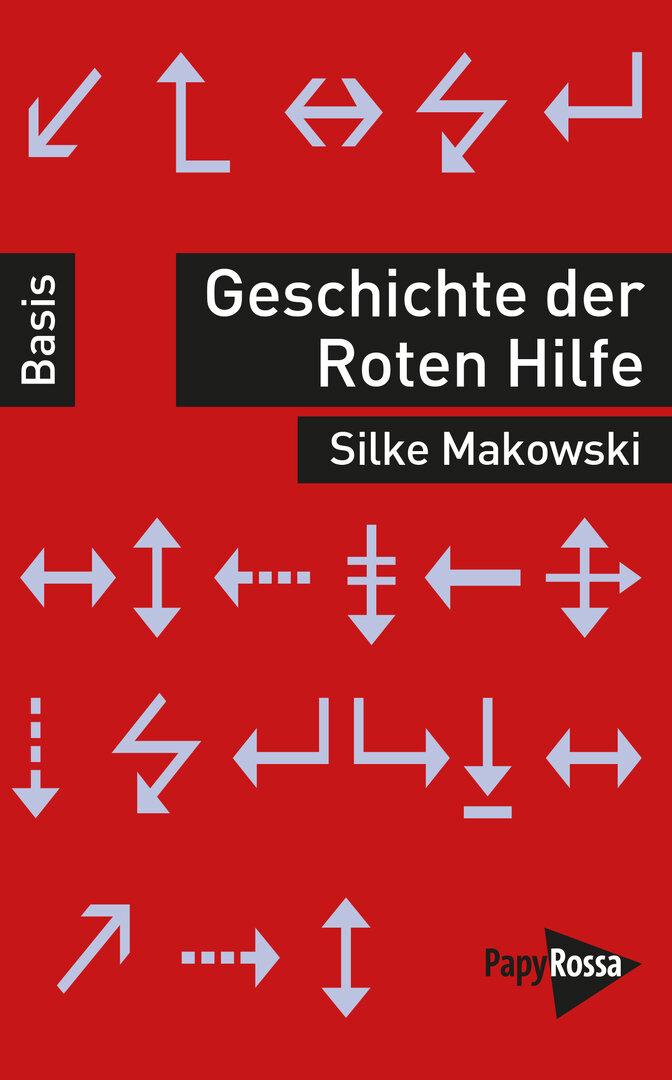Der Bremer Großkaufmann Adolf Lüderitz schloss 1883 einen Vertrag mit Josef Frederiks II., dem traditionellen Führer der Nama. Für 100 Pfund und 200 Gewehre kaufte Lüderitz fünf Meilen Land rings um die Bucht von Angra Pequena, heute Lüderitz. Frederiks ging davon aus, dass die englische Meile gemeint war, 1,6 Kilometer lang. Adolf Lüderitz bevorzugte die preußische Meile, 7,5 Kilometer lang. Das brachte dem Kolonialverbrecher den Spitznamen „Lügenfritz“ ein.
Aus der „zivilisatorischen Mission“, die zu verfolgen der Kolonialismus vorgab, ist heute „Nachhaltigkeit“ geworden, aus der offen erklärten „Kolonialisierung“ eine „Partnerschaft“, die gewohnt einseitig deutschen Interessen dient. Unabhängig von den Regierungen vor Ort hat der deutsche Imperialismus stets verstanden, seine Interessen in Namibia durchzusetzen – bis heute.
Schon 1868 baten Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft den preußischen König um „Schutz“ vor Ort. 1883 begann das Deutsche Reich, das heutige Namibia zu kolonialisieren. „Deutsch-Südwestafrika“ wurde Deutschlands einzige Siedlerkolonie. Von Interesse waren Land- und Viehwirtschaft, Bergbau und die Arbeitskraft der Einheimischen, die man auf drastische Art und Weise ausbeutete.
Trauriger Tiefpunkt dieser Bestialität war der Völkermord an Herero und Nama. Zwischen 1904 und 1908 ermordete die „Schutztruppe“ unter Generalleutnant Lothar von Trotha als „Antwort“ auf einen antikolonialen Aufstand bis zu 100.000 Menschen. Sie töteten etwa 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama. Die Nachfahren der Opfer leiden bis heute unter den Konsequenzen. 70 Prozent des Landes gehört noch immer weißen Farmern.
1915 zerschlugen südafrikanische Truppen den deutschen Kolonialtraum. Sie besetzten die Kolonie, die Deutschland infolge des Versailler Vertrags 1920 offiziell an die „Union von Südafrika“ abtreten musste. 70 Jahre lang hieß die Kolonie nun „Südwestafrika“. Das Interesse an Namibia blieb.
Die South-West Africa People’s Organisation (SWAPO) nimmt 1966 den bewaffneten Kampf gegen die südafrikanische Besatzung auf. Die DDR unterstützt die Befreiungsbewegung mit Waffen und militärischer Ausbildung. Die BRD hingegen verfolgt die ökonomischen Interessen des Monopolkapitals.
Apartheid und Antikommunismus
Bis zur formellen Unabhängigkeit Namibias ordnet Bonn die „Namibia-Frage“ den ausgezeichneten wirtschaftlichen Beziehungen zu Apartheid-Südafrika unter. Überhaupt prägt die Systemkonkurrenz mit den sozialistischen Ländern die Afrika-Politik der BRD in jenen Jahren. Bonn will seinen Alleinvertretungsanspruch durchsetzen, die völkerrechtliche Anerkennung der DDR und die „kommunistische Infiltration“ Afrikas verhindern. Apartheid-Südafrika verstand sich als „Vorposten der freien Welt“ in einem vom Kommunismus „bedrohten“ Afrika.
Zwischen dem Afrikanischen Jahr 1960 und 1968 treten 30 unabhängig gewordene Länder Afrikas den Vereinten Nationen bei. Sie nutzen die Anerkennung der DDR als Druckmittel, um Einfluss auf die Afrika-Politik der BRD zu nehmen. Die USA und die einstigen Kolonialherren Frankreich und Britannien wollen diese jungen, unabhängigen Staaten an sich binden. Unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) beginnt die BRD, von der Hallstein-Doktrin abzurücken, derzufolge sie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR als „unfreundlichen Akt“ gegen sich sieht. Die Aufnahme der BRD in die Vereinten Nationen 1973 – zeitgleich mit der DDR – wird teilweise zu einem Wendepunkt. Nur vor diesem Hintergrund wird die Afrika-Politik der BRD in den 1970er und 1980er Jahren verständlich. Die Bundesregierung spricht sich plötzlich gegen Rassendiskriminierung aus, tastet ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Südafrika allerdings nicht an und lehnt konkrete Maßnahmen gegen Apartheid-Südafrika ab. Sie verstößt damit gegen ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 1971, das die Präsenz Südafrikas in Namibia als rechtswidrig brandmarkt. Das instrumentelle Verhältnis der BRD zum Völkerrecht ist kein Novum. Im Frühjahr 1977 wird die BRD Mitglied der „Kontaktgruppe“ zur Lösung des „Namibia-Konflikts“, nebst Frankreich, Britannien, Kanada und den USA. Für die BRD ist das ein Versuch, aus ihrer Isolierung in den Vereinten Nationen herauszufinden. Die Dekolonisation Namibias ist längst überfällig, und die Regierung in Bonn möchte verhindern, dass sich das Land dem sozialistischen Lager anschließt. Sie will ihre wirtschaftlichen Interessen sichern und die Zukunft der deutschsprachigen Minderheit – der Nachfahren der Kolonisatoren also. Auch diese völkische Komponente ist nichts Neues in der BRD-Außenpolitik.
Zwei Linien
Spätestens mit der Befreiung der portugiesischen Kolonien gerät die BRD gegenüber der DDR in Afrika ins Hintertreffen. Die SED unterhält ab 1977 offizielle Parteibeziehungen zur SWAPO. Damals erkennen die Vereinten Nationen und die Organisation für Afrikanische Einheit, der Vorgänger der Afrikanischen Union, SWAPO als einzige Vertretung des namibischen Volkes an. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) setzt zwar auf Dialog mit der SWAPO, weil er deren Wahlsieg vermutet. Teils unterstützt er die Befreiungsbewegung sogar finanziell. Ende der 1970er Jahre finanziert die Bundesregierung jedoch auch die Abspaltung SWAPO-D von Andreas Shipanga, die Namibia National Front und die Demokratische Turnhallen-Allianz (DTA) mit rund einer Million DM. Die drei Parteien sollen „mäßigend“ auf SWAPO einwirken und den Einfluss der BRD in Namibia langfristig gewährleisten. Die DTA ist Südafrikas Favorit für ein „unabhängiges“ Namibia. 1983 empfängt Bundeskanzler Helmut Kohl eine Delegation dieser Partei, als erster Regierungschef der Kontaktgruppe.
Das Verhältnis der BRD zur SWAPO kühlt sich folgerichtig ab in den 1980er Jahren. Die Unabhängigkeitsverhandlungen stehen still. Kanzler Kohl fördert verstärkt Projekte nichtstaatlicher Träger in Namibia. Meldungen, die BRD plane, Atommüll in Namibia zu lagern, verschlechtern die Beziehung zur SWAPO weiter.
1985 setzt Südafrika eine Interimsregierung in Windhoek ein. DTA und SWAPO-D sind an ihr beteiligt. An den Reaktionen darauf in Bonn zeigen sich zwei Linien, die innerhalb der Bundesregierung um Durchsetzung ringen. Genscher nennt die Interimsregierung „null und nichtig“. Entwicklungshilfeminister Hans Klein (CSU) hingegen würdigt ihre Arbeit. Die Union setzt auf die DTA und die „Kooperation“ mit der deutschsprachigen Minderheit. Zu diesem Zeitpunkt können deutschstämmige Namibier im Ausland die BRD-Staatsbürgerschaft erwerben, ohne je in Deutschland gelebt zu haben. Die Grünen unterstützen die SWAPO, die SPD im Wesentlichen auch.
„Heute Völkermord“
Im Zuge des Unabhängigkeitsplans von 1989 empfängt die Bundesregierung Vertreter von SWAPO und DTA. Zwei Tage vor seiner Reise nach Bonn sagt SWAPO-Führer Sam Nujoma der namibischen Presse, man habe nicht gegen die südafrikanische Besatzung gekämpft, um unter „eine neo-koloniale Herrschaft der Bundesrepublik“ zu geraten. Bonn schickt etwa 50 Wahlbeobachter, 170 Fahrzeuge und 60 Kfz-Mechaniker nach Windhoek, um die Umsetzung des Plans zu flankieren.
Am 21. März 1990 wird Namibia formell unabhängig. Tags darauf eröffnet die DDR eine Botschaft in Windhoek – ihre letzte. Auch die BRD nimmt sofort diplomatische Beziehungen auf. Der erste hochrangige Staatsbesuch findet erst im März 1998 statt, als Bundespräsident Roman Herzog Namibia besucht. Noch länger dauert es, bis über Deutschlands Kolonialverbrechen gesprochen wird. Im August 2004 erkennt Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) die „historische und moralische Verantwortung Deutschlands“ an für das, was „heute als Völkermord bezeichnet würde“ – 100 Jahre nach diesem Genozid. Wieczorek-Zeul war kaum zurück in Berlin, als die Bundesregierung ihre Aussage als „Privatmeinung“ zurückwies. Erst 2016 erkannte die Regierung den Völkermord in einem offiziellen Dokument an.

Mit der Aufarbeitung der Kolonialverbrechen hat es die Bundesregierung bis heute nicht eilig. Erste während der Kolonialzeit geraubte Schädel gab sie 2011 zurück, weitere folgten 2014 und 2018. Heute sollen noch etwa 7.000 solcher Schädel in deutschen Museen und Sammlungen liegen. 2015 begannen Verhandlungen zwischen den Regierungen Namibias und der BRD über eine offizielle Entschuldigung und „Hilfsgelder“. Im Mai 2021 hieß es dann, man habe eine Einigung erzielt. 1,1 Milliarden Euro will die Bundesregierung über 30 Jahre für Infrastruktur und Entwicklung in Namibia ausgeben. Von Reparationen ist keine Rede, die BRD will einen juristischen Präzedenzfall verhindern. Ein Großteil des Geldes soll in „Entwicklungsfonds“ fließen. Vertreter der Opferverbände und traditionelle Autoritäten Namibias nennen die „Einigung“ eine „schockierende Offenbarung“, „inakzeptabel“, gar einen „Affront gegen unsere Existenz“. Der ausgehandelte Betrag ist nur ein Bruchteil dessen, was die Nachfahren der Opfer fordern. Zum Vergleich: In den 30 Jahren von 1990 bis 2020 hat die BRD 1,4 Milliarden Euro an „Entwicklungshilfe“ an Namibia überwiesen.
An den Opfern vorbei
Die „Gemeinsame Erklärung zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen“ wurde paraphiert, aber bis heute nicht von den Vertragspartnern unterzeichnet und umgesetzt. Die Bundesregierung hatte über die Vernichtungskriege gegen Herero und Nama, über die Internierung Überlebender in KZ, deren Enteignung und die entwürdigende Verbringung menschlicher Überreste nach Deutschland für pseudowissenschaftliche Forschung diskutiert, ohne Vertreter der Opferverbände einzuladen. „Was für eine Versöhnung soll das sein, wenn die Betroffenen keine Rolle darin spielen?“, fragte Esther Muinjangue, Vorsitzende des Ovaherero Genocide Committee.
Die Nachfahren der Opfer wehren sich mit der Parole „Alles über uns ohne uns ist gegen uns!“ dagegen, erneut zu Opfern gemacht zu werden. Sie üben Druck auf das namibische Parlament aus, den Vertrag nicht zu ratifizieren. Die amtierende Bundesregierung hat im Sommer noch einmal bekräftigt, das Konzept der Wiedergutmachung sei im Kontext der kolonialen Vergangenheit Deutschlands nicht anwendbar, weil es zum Zeitpunkt der Gewalttaten noch kein Völkerstrafrecht gegeben habe. Kaum jemand rechnet noch damit, die Erklärung werde in der laufenden Legislatur angenommen.
Die BRD ist heute der wichtigste Handelspartner Namibias. Deutschland exportiert Maschinen, Lebensmittel, Elektrotechnik und Elektronik, chemische Produkte, Autos und Mess- und Regeltechnik dorthin. Namibia liefert Nichteisenmetalle, Nahrungsmittel, Rohstoffe, Maschinen, Lederwaren und natürliche Öle. Diese Exportgüter sind überwiegend extraktiver Natur: unverarbeitete Rohstoffe und wenig veredelte Produkte, die Wertzuwachs zuhause ermöglichen. Mehrere bilaterale Wirtschaftsabkommen regeln den Handel. Das Auswärtige Amt nennt die Beziehungen zu Namibia „vielfältig und eng“. Als „zentrale Anliegen“ benennt das Auswärtige Amt „Entwicklungszusammenarbeit“, Tourismus, die „Aufarbeitung des Völkermords“, die von der BRD gewünschte Reform der UN sowie die Produktion grünen Wasserstoffs.
Letzterer führte den damaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Dezember 2022 nach Namibia – mit der größten Wirtschaftsdelegation, die das Land je besucht hat. Habeck unterzeichnete dort eine Absichtserklärung für den Bau einer der „weltweit größten Anlagen für grünen Wasserstoff“ in Lüderitz und Umgebung. Der deutschsprachigen namibischen „Allgemeinen Zeitung“ sagte er danach: „Im Zentrum steht, dass wir – wenn es gewünscht wird – Namibia unterstützen, saubere, verlässliche und preiswerte erneuerbare Energiequellen zu erschließen. Wenn Namibia dann einen Überschuss dieser Energiequellen erwirtschaftet, würden wir sehr gern diese Produkte importieren.“ Mit „diese Produkte“ meinte Habeck nur eines: Ammoniak, ein besser transportierbares Derivat von Wasserstoff. Die chemische Industrie nutzt Ammoniak zur Herstellung von Kunstdünger. Chemische Industrie gibt es in Namibia kaum. Das Investitionsvolumen entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt Namibias. Das Land soll sich mit 24 Prozent an den Investitionen beteiligen und dafür Kredite bei europäischen Banken aufnehmen. Geht das Projekt schief, droht die Schuldenfalle. Habecks Aussage in der „Allgemeinen Zeitung“ ist eine groteske Verkehrung – es geht natürlich um den Energiehunger der BRD. Auf Lüderitz’ Meilenschwindel folgt Habecks Mengenschwindel.