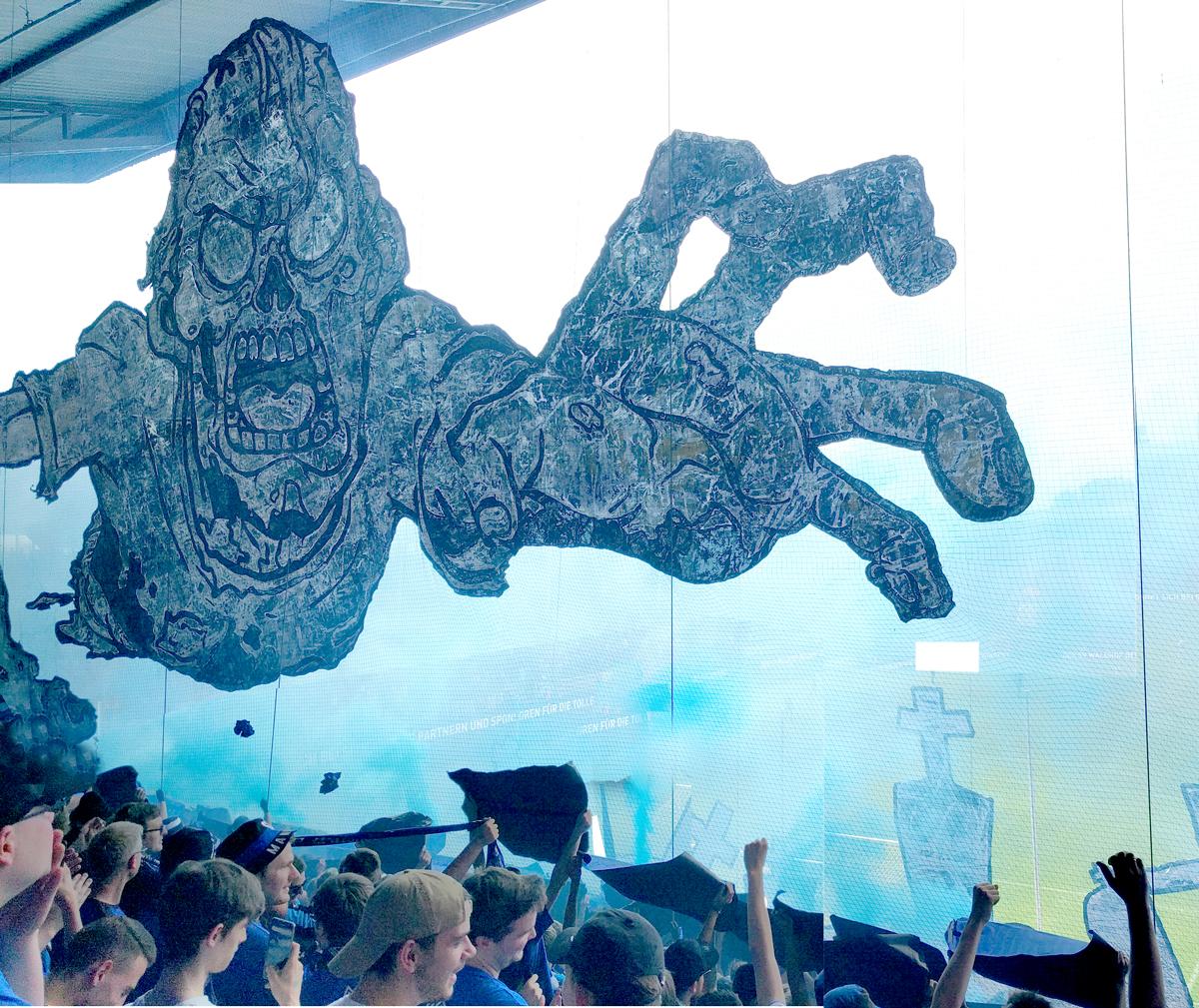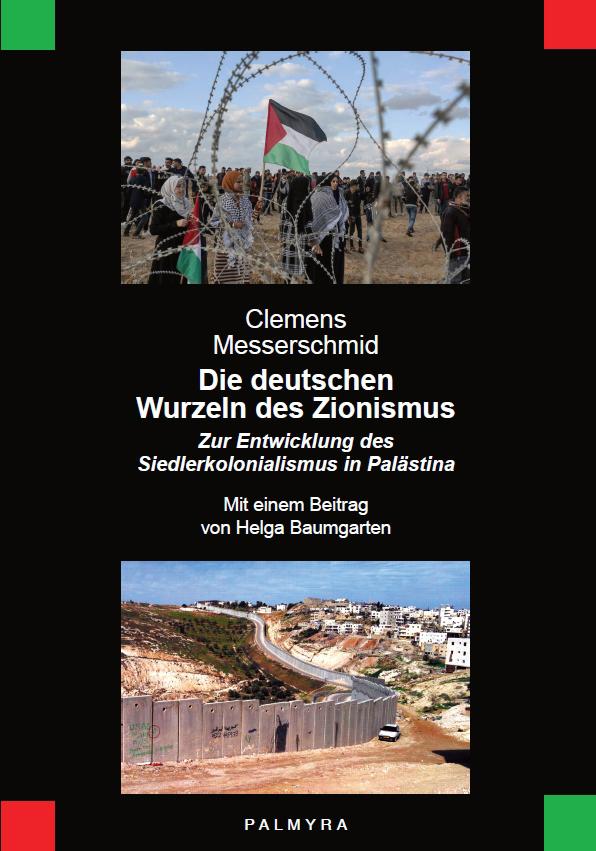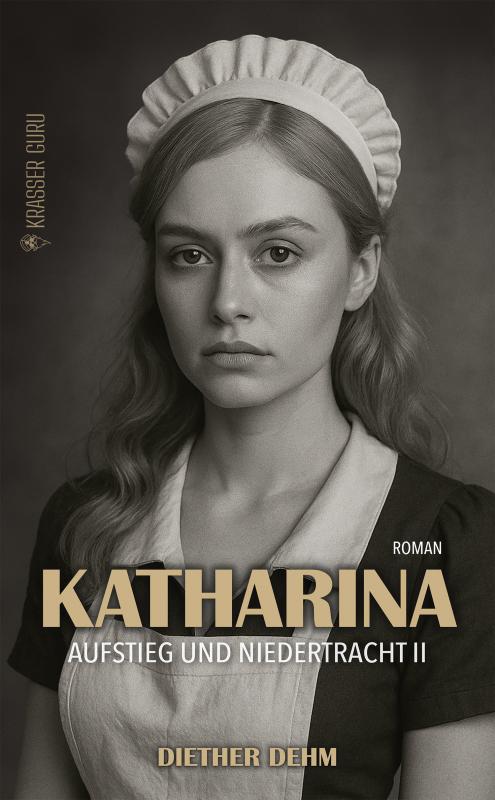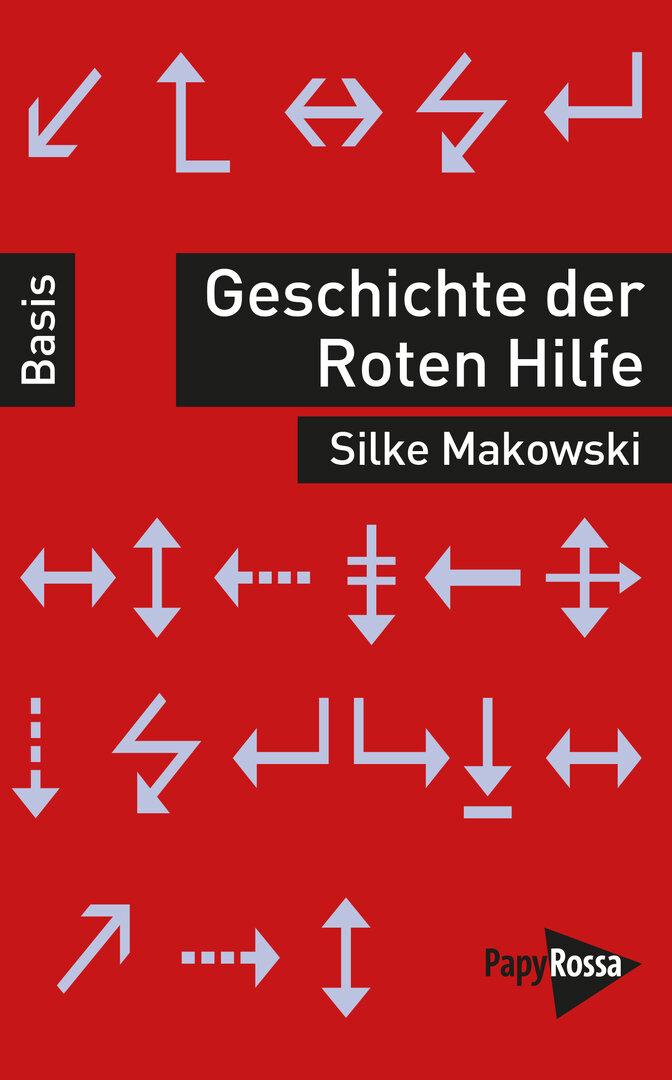Keine Mittel für sozialen Wohnungsbau, aber eine Billion Euro für „Kriegstüchtigkeit“: Die neue Bundesregierung hat die Weichen Richtung Weltkrieg schon vor ihrem Amtsantritt gestellt. Protest dagegen aus den Gewerkschaften ist kaum zu vernehmen. Eine Ausnahme: Jörn Rieken, Mitglied des Bezirksvorstands der IG BAU Berlin. UZ sprach mit ihm darüber, wie Gewerkschafter für Frieden kämpfen können.
UZ: Du warst einst bei der Bundeswehr. Wie kommt es, dass du dich heute für Frieden einsetzt?
Jörn Rieken: 1977 war ich im Artillerieführungs- und Aufklärungsbataillon 3 in Stade stationiert. Das sollte, falls es zu einem Krieg gegen die Sowjetunion gekommen wäre, einen atomaren Wall errichten, der Hamburg einschließen sollte. Das Szenario sah folgendermaßen aus: Die sowjetischen Truppen nehmen die norddeutsche Tiefebene ohne größere Gefechte ein. Deren Vormarsch sollte schließlich an der Elbe gestoppt werden. Zu diesem Zweck sah die Gefechtsplanung einen atomaren Gürtel am Ostufer der Elbe vor. Es gab eine Vorwarnzeit von wenigen Stunden, während der ungefähr 30.000 Entscheidungsträger aus Hamburg hätten evakuiert werden sollen. Anschließend wäre der Gürtel gelegt worden. Man ging von ungefähr zwei Millionen Verseuchten aus.
Ich habe daraufhin verweigert und musste eine ausführliche Befragung des Militärischen Abschirmdienstes über mich ergehen lassen. Die anschließenden Monate bis zur Verhandlung meiner Verweigerung wurde ich nur noch mit dem Fegen von Kellern beauftragt. Die Verhandlung selbst dauerte nur wenige Minuten, in der ich nur meine Begründung aussagen musste. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Zwar hatten auch einige Medien, etwa „Der Spiegel“, in groben Zügen über das angedachte Szenario berichtet, inklusive der atomaren Kollateralschäden bei der eigenen Bevölkerung. Aber die konkreten Auswirkungen sollten wohl der Öffentlichkeit vorenthalten werden.
UZ: Der abgewählte Bundestag hat kürzlich Kriegskredite verabschiedet. Teil davon ist ein 500 Milliarden Euro teures „Infrastrukturprogramm“. Die IG BAU fordert ein Investitionsprogramm über 50 Milliarden Euro binnen vier Jahren. Was unterscheidet die beiden Programme?

Jörn Rieken: Eines der drängendsten Probleme ist die Wohnungsnot. Die IG BAU fordert seit Jahren, dass der Staat aktiv wird. Private Investoren investieren kaum mehr in sozialen Wohnungsbau, trotz steuerlicher Anreize und nur 20-jähriger Sozialpreisbindung. Kommerzielle Investoren setzen ihre Mittel fast ausschließlich im Hochpreis- oder oberen Mittelsegment ein. Die einzige Möglichkeit, das Problem des Wohnungsmangels zu beheben, liegt im öffentlichen Wohnungsbau. Das effektivste Mittel wäre, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften dabei zu unterstützen, Wohnungen zu bauen. Wohnungsbau ist inzwischen Ländersache. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Einnahmebasis der Bundesländer auszuweiten, liegt in der Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Berlin könnte sie von 6,5 auf 18 Prozent anheben – das ist die Größenordnung von Brüssel, Sydney oder Vancouver. Eine verdreifachte Grunderwerbsteuer würde sicherlich einige Spekulanten abschrecken, aber zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1 bis 1,5 Milliarden Euro pro Jahr generieren. Diese zusätzlichen Einnahmen könnten als Investitionszuschüsse an landeseigene Wohnungsgesellschaften gegeben werden.
Die IG BAU fordert seit Jahren 50 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau als Investitionszuschuss an landeseigene Wohnungsgesellschaften. Allerdings ist diese Forderung nicht genau spezifiziert und somit offen für die bisherige Finanzierung, bei der kommerzielle Investoren Zuschüsse erhalten. Das führt zu der seit Jahren anhaltenden Misere, dass mehr Sozialwohnungen aus der Mietbindung herausfallen, als neue gebaut werden. Als Mindestkriterium fordert die IG BAU, die Sozialpreisbindung auf 50 Jahre zu erhöhen.
Von den 500 Milliarden Sonderschulden für Investitionen, die der Bundestag kürzlich beschlossen hat, gehen nur 100 Milliarden an Länder und Kommunen. So heißt es jedenfalls, festgeschrieben im Koalitionsvertrag ist das nicht. Das ist völlig unzureichend! Nach übereinstimmenden Äußerungen fast aller beteiligten Entscheidungsträger ist sozialer Wohnungsbau in den Sonderschulden definitiv nicht enthalten. Die restlichen 400 Milliarden Euro sollen nur für kriegsrelevante Infrastruktur ausgegeben werden. Dazu gehört der Umbau des Krankenhauswesens, um die Vorgabe erfüllen zu können, 1.000 Schwerverletzte pro Tag zu versorgen, inklusive bombensicherer Operationssäle. Dazu sollen Ost-West-Verbindungen, Autobahnen und Eisenbahnen für militärische Transporte ausgebaut werden, insbesondere panzertragfähige Brücken.
UZ: Nur selten hört man kritische Stimmen aus den Gewerkschaften gegen den Kriegskurs der Bundesregierung. Eine Ausnahme ist ein Beschluss vom 19. September 2024 des Bezirksvorstands der IG BAU Berlin, in dem du Mitglied bist, die bundesweite Friedensdemonstration in Berlin am 3. Oktober 2024 zu unterstützen.
Jörn Rieken: Dafür gab es eine eindeutige Mehrheit, das war schon erstaunlich. Gewerkschaften wissen eigentlich, dass Krieg immer zulasten der abhängig Beschäftigten geführt wird. Da müsste es eigentlich viel mehr Konsens geben, wenn es zu entsprechenden Abstimmungen kommt, auch in anderen Gruppierungen. Bisher habe ich nur wenig davon gehört. Ein positives Zeichen war, dass auf dem ver.di-Bundeskongress 2023 eine ähnliche Diskussion geführt wurde. Ein Antrag gegen Aufrüstung und für soziale Investitionen erhielt zwar nur 30 Prozent der Stimmen, wurde aber fast einen ganzen Tag lang diskutiert, so dass der Gewerkschaftstag verlängert werden musste. Ein sehr gutes Zeichen, dass die Gewerkschaftsführung gezwungen war, die Debatte aufzunehmen. Weiterhin gibt es von oben erheblichen Druck, die Finanzierung des vorgesehenen Krieges nicht zu thematisieren. So ist die eintägige Diskussion kaum in die Öffentlichkeit getragen worden.
UZ: Wie kann man gegen diesen Druck von oben wirken?
Jörn Rieken: Zum Beispiel so, wie wir es in Berlin gemacht haben: Auf Bezirksebene möglichst viele Beschlüsse zu fassen. Zum Beispiel, um zum Ostermarsch aufzurufen. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Man muss Diskussionen einfordern. Die werden von den Gewerkschaftsführungen eher ignoriert als aktiv verhindert. Man muss dabei immer im Kopf haben: 98 Prozent der in gewerkschaftlichen Grundeinheiten diskutierten Fragen sind organisatorische Fragen, inhaltliche maximal 2 Prozent. Aber auf diese 2 Prozent müssen wir drängen, und wir müssen sie auf 3 oder 5 Prozent hochbringen.
Das Problem dabei ist: unterschiedliche Ansichten gibt es immer. Die Gewerkschaft ist aber eine Einheitsgewerkschaft. Diese Einheit möchten fast alle unbedingt verteidigen. Daher gibt es oft auch innere Widerstände dagegen, Dissens auszusprechen. In grundsätzlichen Fragen wie der Umverteilung von Mitteln des Sozialstaats in den vorgesehenen Kriegsführungsstaat müssen wir das aber tun.
UZ: Die drastisch erhöhten Ausgaben für Rüstung schränken den Spielraum für Gewerkschaften ein, wie auch die fortschreitende Deindustrialisierung. Gleichzeitig nehmen Angriffe auf das Streikrecht zu.
Jörn Rieken: Angriffe auf das Streikrecht werden immer mal wieder vorgetragen, besonders natürlich in Krisenzeiten. Insofern sehe ich das als normales Krisenphänomen. Was sich jetzt tatsächlich verändert hat, ist – das zeigt die Wortwahl von Boris Pistorius und führenden Militärs –, dass es 2029 nicht um die eigene Verteidigung geht, sondern um einen Angriffskrieg. Wir müssen „kriegsfähig“ werden. Das Wort wird in militärischer Sprachregelung immer dann benutzt, wenn Angriffskrieg geplant wird. Bis 2029 soll Russland so ausgeblutet sein, dass es direkt angegriffen werden kann. Aber die Russische Föderation ist kein militärisch schwaches, sondern ein verteidigungsfähiges Land mit dem zweitgrößten Atomwaffenarsenal der Welt. Das ist ein ganz anderes Szenario als die Kriege der letzten Jahre. Wenn der Krieg gegen Russland geführt wird, werden die Schäden in der Bundesrepublik extrem hoch sein. Bei den politisch Verantwortlichen scheinen solche Überlegungen den Wunsch zur Angriffsfähigkeit nicht zu schwächen.
UZ: Wie ordnest du den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst ein hinsichtlich des Kriegskurses der Bundesregierung?
Jörn Rieken: Insgesamt über eine Billion Euro werden als Schulden aufgenommen. Die Bundesbank sagt, der konjunkturelle Impuls, der ja zum Teil von der Sozialdemokratie erwartet wird, der „Militär-Keynesianismus“, könnte zu einem Wachstum des BIP von 1,1 bis 1,3 Prozent führen. Der volkswirtschaftliche Investitionsaufwand dafür liegt aber zwischen 3 und 4 Prozent des BIP, denn Militärausgaben gelten volkswirtschaftlich nicht als Investition, sondern als Konsumausgabe. Ein volkswirtschaftlicher Verlust, der den sich seit drei Jahren hinziehenden Abstieg Deutschlands verstetigen wird, ist folglich abzusehen. Donald Trumps Zölle dürften das wirtschaftliche Potential Westeuropas um weitere 0,7 bis 1,1 Prozent beschneiden. Dieser absehbare BIP-Einbruch beträgt damit weniger als die Hälfte der Einbußen durch das Aufrüstungsprogramm. Medial sind Trumps Zölle der Hype, während der volkswirtschaftliche Einbruch durch das Aufrüstungsprogramm totgeschwiegen wird.
Das Problem ist – auch die Bundesbank hat das so aufgelistet –, dass ab 2027, wenn sowohl die Tilgungsraten der Corona-Schulden als auch die ersten Raten aus dem 100-Milliarden-„Sondervermögen“ der Regierung Olaf Scholz zurückgezahlt werden müssen, alleine die Zinsen dafür die Ausgaben für den Militärhaushalt überschreiten – selbst wenn der auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht wird! Mit den Zins- und Tilgungsraten von Corona, Scholz’ „Sondervermögen“ und dem jetzigen Aufrüstungsprogramm plus 3,5 Prozent des BIP für Rüstungskonsum landen wir bei 80 Prozent des Bundeshaushaltes. Der besteht aber zu etwas mehr als 70 Prozent aus laufenden Ausgaben. Wenn 80 Prozent für Krieg und Militär ausgegeben werden, ist der laufende Haushalt nicht mehr zu finanzieren. Die USA zahlen schon seit 2016 oder 2017 fast genau so viel Zinsen, wie sie für ihr Militär ausgeben. Die können sich das leisten, weil sie ihre Dollars durch Gelddrucken vermehren können, da der US-Dollar als weltweite Handels- und Anlagewährung gilt. Das kann die Bundesrepublik nicht. Es wird also massiv bei Lohn- und Gehaltszahlungen gekürzt werden.
Den Vorboten sehen wir jetzt: In den meisten verhandelten Branchentarifverträgen wird kaum die Inflation ausgeglichen. Dazu kommen massiv gestiegene Sozialabgaben. Wir erreichen noch nicht einmal das Reallohnniveau von 2019. Das Lohnniveau wird noch tiefer sinken.
UZ: Zu den Kriegsvorbereitungen der Bundesregierung gehört die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Jörn Rieken: Da besteht definitiv Aufklärungsbedarf in den Gewerkschaftsjugenden. In Britannien, Italien oder Spanien soll die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht sein. Die Bevölkerungen Deutschlands und Frankreichs stimmen angeblich mehrheitlich zu. In der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen, also denjenigen, die tatsächlich eingezogen werden würden, überwiegt die Ablehnung. Vor allem Ältere stimmen zu, die selbst der Wehrpflicht unterlagen, jetzt aber nicht mehr persönlich betroffen sind. Wobei: Die Ukraine zieht bis zu 55-Jährige ein. Das dürfte auch auf uns zukommen, wird aber noch nicht diskutiert.
In der IG BAU ist die Gewerkschaftsjugend natürlich dagegen. In der breiten Bevölkerung ist das Thema bisher noch nicht richtig angekommen. Im Moment werden eher verbale Testballons gestartet von Einzelnen, die das Feld sondieren. Solche Stimmungsumschwünge brauchen einen langen medialen Vorlauf, im Regelfall ein bis eineinhalb Jahre. Angesichts der medial verbreiteten hysterischen Russophobie in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger.
Kaum jemand beschäftigt sich damit, wie Krieg abläuft, was Krieg tatsächlich bedeutet. Praktisch jeder Rekrut lernt schon in der Grundausbildung: Wenn du einen Angriff tätigen willst, musst du im offenen Feld eine dreifache Überlegenheit haben, im Häuserkampf eine fünffache. Ich war bei der Artillerie. Im Gefecht hatte ein Artilleriebeobachter eine Überlebenszeit von zehn Minuten. Pioniere haben eine von sieben Minuten, Infanterie eine von 15 Minuten. Wenn du Wehrpflicht geleistet hast, weißt du das. Im Krieg musst du schon ganz viel Glück haben, um zu überleben, wenn du im Gefecht an der Front bist. Diese persönliche existenzielle Bedrohung bekommst du im Wehrdienst mit. Krieg heißt: Jemand will dich umbringen und du musst den umbringen. Da geht es um die nackte Existenz. Und dann funktionierst du. Es gibt extrem wenige, die sich im Gefecht weigern zu schießen, oder die überlaufen.